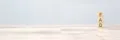
Häufig gestellte Fragen
Auf dieser Seite beantworten wir häufig gestellte Fragen rund um FORCAM ENISCO, unsere Lösungen sowie typische Einsatzszenarien in der Fertigung. Nutzen Sie das Inhaltsverzeichnis, um direkt zu dem Bereich zu springen, der für Sie relevant ist, und gezielt die passende Antwort zu finden.
Häufig gestellte Fragen
Übersicht
- Allgemeine Fragen
-
Shopfloor Apps
2.1 AC4DC – Next-Gen Shopfloor Connectivity -
Funktionalitäten
3.1 Produktionsüberwachung
3.2 Produktionssteuerung
3.3 Visualisierung und Reporting
3.4 Personalzeiterfassung
3.5 Track and Trace / Rückverfolgbarkeit
3.6 Energiemonitoring
3.7 Maschinendatenerfassung
3.8 Dokumentenmanagement
3.9 Feinplanung
3.10 3D-Visualisierung -
Cloud MES
4.1 SAP Digital Manufacturing (SAP DM)
4.2 SAP Resource Orchestration (SAP REO)
4.3 SAP Digital Manufacturing: Execution
4.4 SAP Digital Manufacturing: Insights -
On-Premise MES
5.1 MES FLEX
5.2 E-MES
5.3 MES LITE - Beratung
- Weiterführende Fragen
Allgemeine Fragen
-
Diskrete Fertigung ist ein Fertigungsprozess, bei dem aus verschiedenen Bauteilen einzelne Produkte hergestellt werden, die erstens zählbar sind und zweitens wieder in ihre Bestandteile zerlegt werden können. Zu Produkten einer diskreten Fertigung gehören unter anderem Autos, Flugzeuge, Möbel, Smartphones u.v.m. Diese Produkte werden oft in großen Stückzahlen hergestellt, aber jeder Artikel wird als eigene Einheit hergestellt und verkauft.
Im Gegensatz dazu werden in der sogenannten Prozessfertigung (auch: Prozessindustrie) Massenartikel in Chargen hergestellt, die nach Formeln oder Rezepten produziert und nicht in ihre ursprünglichen Bestandteile zerlegt werden können (Chemie, Pharma, Lebensmittel- und Getränkeherstellung).
-
Ein Manufacturing Execution System (MES) ist ein Fertigungsmanagementsystem, das komplexe Fertigungsprozesse abbildet, überwacht und steuert.
Die Ziele eines MES
Ein Manufacturing Execution System (MES) verfolgt mehrere zentrale Ziele, die dazu beitragen, die Effizienz, Qualität und Kontrolle in der Fertigung zu verbessern:
- Effizienzsteigerung: Durch die Automatisierung und Optimierung von Fertigungsprozessen trägt ein MES zur Reduzierung von Durchlaufzeiten, zur Minimierung von Stillstandszeiten und zur Verbesserung der Gesamtanlageneffektivität (OEE) bei.
- Qualitätsmanagement: Ein MES ermöglicht eine präzise Überwachung und Kontrolle der Produktionsprozesse in Echtzeit. Dadurch werden Fehler minimiert, die Rückverfolgbarkeit verbessert und die Einhaltung von Qualitätsstandards sichergestellt.
- Bestandsmanagement: Durch genaue Datenerfassung und -verarbeitung unterstützt ein MES die Optimierung von Lagerbeständen und Materialflüssen. Dies führt zu reduzierten Beständen, geringeren Lagerkosten und besserer Planbarkeit.
- Nachhaltigkeit und Compliance: MES-Lösungen helfen dabei, Umweltstandards einzuhalten und gesetzliche Vorgaben zu erfüllen. Sie ermöglichen eine genauere Ressourcenplanung und -nutzung, was zu einer Verringerung des ökologischen Fußabdrucks beiträgt.
- Echtzeit-Datenanalyse und Entscheidungsfindung: Durch die Bereitstellung aktueller Daten und aussagekräftiger Analysen unterstützt ein MES das Management bei der schnellen Entscheidungsfindung. Dadurch können Probleme frühzeitig erkannt und behoben sowie Chancen zur Optimierung genutzt werden.
- Integration und Skalierbarkeit: Ein MES fungiert als zentrale Plattform, die verschiedene Fertigungssysteme und -prozesse integriert. Dadurch ist es skalierbar und kann an die spezifischen Anforderungen und Veränderungen in der Fertigung angepasst werden.
Insgesamt zielt ein MES darauf ab, die gesamte Fertigungsleistung zu optimieren, Kosten zu senken, die Produktqualität zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens zu stärken. Dies gelingt, indem es genaue Echtzeitdaten über den gesamten Produktionslebenszyklus hinweg sammelt und aufbereitet.
Nachfolgende werden einige wichtige Funktionalitäten eines MES-Systems vorgestellt. Dazu gehören die Maschinendatenerfassung (MDE), Betriebsdatenerfassung (BDE), Leistungsanalyse, Feinplanung, Rückverfolgbarkeit und Dokumentenmanagement.
Shopfloor Apps
AC4DC – Next-Gen Shopfloor Connectivity
-
AC4DC steht für die englische Abkürzung „Asset Connectivity for Data Collection”. Also etwa “Maschinen anbinden, um Daten zu sammeln”. Der Begriff „Asset“ ist dabei der Oberbegriff für Maschinen, Sensoren oder Handarbeitsplatz-Komponenten, die digital angebunden werden sollen.
-
AC4DC bietet vor allem 4 Verbesserungen für Kunden:
- Eine stabilere und widerstandsfähigere Datenversorgung. Das wird erreicht, weil die Datenerfassung über kleine und kostengünstige Hardware ausfallsicher gestaltet werden kann und scheinbar verlorene Daten schnell wiederhergestellt werden können. Mehr erfahren
- Erhöhte Datensouveränität und Cybersicherheit. Das wird erreicht, weil Datenströme einfacher als bei anderen Lösungen verschlüsselt werden können. So wird auch die Datenintegrität verbessert. Mehr erfahren
- Schnelle und flexible Implementierung der Konnektivität. Das wird durch standardisierte Vorlagen (Templates) sowie eine zentrale Steuerung via Kontrollzentrum erreicht. Eine „Plug-and-Play“-Kompatibilität minimiert Installations- und Wartungsaufwand. Mehr erfahren
- Schnelle Skalierbarkeit der Anbindung. Das wird durch die Cloud erreicht. Zudem ist die Lösung anpassungsfähig an unterschiedlichste Anwendungsfälle. Die Signalinterpretation entspricht der IEC-Norm, was den Umschulungsbedarf reduziert. Mehr erfahren
-
Mit AC4DC bietet FORCAM ENISCO eine völlig neue Software-Generation. Die Lösung basiert auf sogenannten Microservices, arbeitet mit Kubernetes und läuft auf kleinsten Industrie-PCs.
Microservices sind vergleichbar mit Legobausteinen, die man wie standardisierte Container zu immer neuen Formen kombinieren und erweitern kann. Kubernetes ist die Plattform, die die zusammengesetzten Container erkennt, zusammenstellt und die jeweiligen Programme startet.
Containerisierte Software in kleinster Hardware – das bringt große Vorteile für Kosteneffizienz, Datensouveränität und Datensicherheit. Insgesamt können Anwender mit AC4DC die Flexibilität und Ausfallsicherheit in der Produktion deutlich erhöhen.
Funktionalitäten
Produktionsüberwachung
-
Die Produktionsüberwachung gleicht der Leitung eines Orchesters: Wie ein Dirigent das Zusammenspiel vieler Musiker und ihre Instrumente leitet, so sorgt Produktionsüberwachung für eine transparente und effiziente Steuerung aller Prozesse in der Fertigung.
Die Aufgabe der Produktionsüberwachung ist komplex. Viele Faktoren spielen eine Rolle – das Produkt selbst, Marktanforderungen, gesetzliche Regelungen. Entscheidend sind daher verschiedene Komponenten wie Feinplanung, Visualisierung, Erfassung, Energiemonitoring und Steuerung.
Produktionssteuerung
-
Die Produktionssteuerung ist die Schnittstelle zwischen Auftragseingang und Produktion. Sie sorgt dafür, dass die richtigen Produkte in der richtigen Menge zur richtigen Zeit und am richtigen Ort hergestellt werden – so kostengünstig wie möglich.
-
Die zunehmende Komplexität der Märkte, die steigende Individualisierung der Produkte und der zunehmende Wettbewerbsdruck stellen die Produktionssteuerung vor immer neue Herausforderungen:
- Globalisierung und Digitalisierung: Fertigungsnetzwerke müssen zunehmend global und digital vernetzt werden.
- Individualisierung und Losgröße 1: Kunden wünschen immer individuellere Produkte, was zu kleineren Losgrößen und einer höheren Variantenvielfalt führt.
- Nachhaltigkeit: Die Reduktion von Ressourcenverbräuchen und Emissionen gewinnt in der Industrie im Zuge von Berichtspflichten zur Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung.
-
Die Wahl der richtigen Methode der Produktionssteuerung hängt von verschiedenen Faktoren ab – wie z.B. der Unternehmensgröße, den strategischen Zielen, dem Produktportfolio, der Produktionsumgebung.
Zentrale Produktionssteuerung
Es werden alle Entscheidungen und Planungen an einer zentralen Stelle getroffen, um Kosten zu sparen. Eine zentrale Produktionssteuerung ermöglicht zudem eine hohe Transparenz und Kontrolle über den Gesamtprozess. Diese Methode eignet sich für Unternehmen mit einem überschaubaren Produktportfolio und stabilen Produktionsbedingungen.
Digitale Produktionssteuerung
Die digitale Produktionssteuerung ist für Unternehmen essenziell auf dem Weg zur Smart Factory. Durch die Nutzung digitaler Technologien können Unternehmen ihre Produktionsprozesse weitaus effizienter, flexibler und transparenter gestalten.
Kanban Produktionssteuerung
Beim Kanban-Prinzip wird die Produktion durch den Bedarf der nachfolgenden Produktionsstufe gesteuert. Signalkarten – japanisch „Kanban“ – lösen den Nachschub aus, sobald ein bestimmter Materialbestand erreicht ist. So wird Überproduktion und ein hoher Lagerbestand vermieden. Die Kanban-Methode zeichnet sich durch Einfachheit und Effizienz aus.
-
Mit Hilfe moderner, in ERP-Systeme implementierbarer Softwarelösungen von FORCAM ENISCO oder SAP Digital Manufacturing, sind Produktionsprozesse effizient plan- und steuerbar. Um unterschiedliche Produktionsstrategien und -prozesse zu kategorisieren, die für eine effiziente Herstellung notwendig sind, unterscheidet man drei Fabriktypen nach Anzahl der gefertigten Produktvarianten*:
- Einzelfertigung: Herstellung von Unikaten nach Kundenwunsch (z.B. Schiffe, Brücken). Bei den Prozessen bestehen meist lange Durchlaufzeiten, sie benötigen eine hohe Qualifikation der Mitarbeitenden und verursachen in der Regel hohe Produktionskosten.
- Serienfertigung: Produktion einer bestimmten Anzahl nahezu identischer Produkte in Serie (z.B. Autos, Computer, Möbel). Die Prozesse sind meist teilautomatisiert und benötigen kürzere Durchlaufzeiten als bei der Einzelfertigung.
- Massenfertigung: Herstellung großer Mengen identischer Produkte über einen langen Zeitraum (z.B. Schrauben, Lebensmittel oder Produkte in Chemie- oder Elektroindustrie). Die Prozesse sind in der Regel hochautomatisiert, die Produktionskosten pro Stück vergleichsweise gering.
Visualisierung und Reporting
-
Vereinfacht gesagt heißt Visualisierung, die erfassten Daten in eine „sichtbare“ Form zu bringen – beispielsweise als übersichtliche Diagramme, Grafiken oder mit interaktiven Echtzeit-Dashboards. Anstelle von unübersichtlichen Zahlenkolonnen erhält man ein klares Bild der Produktion oder des gesamten Unternehmens und kann Trends, Zusammenhänge und Auffälligkeiten auf einen Blick erfassen, Informationen können so teamübergreifend einfacher ausgetauscht werden.
Mit Digital Manufacturing kann sowohl mit den MES-Lösungen SAP Digital Manufacturing als auch mit MES FLEX von FORCAM ENISCO auf diese Weise völlige Transparenz über Ihre Produktion erlangt und der dadurch der Workflow optimiert werden.
-
Das Reporting ist quasi das „Berichtswesen“ der Visualisierung und bettet die erfassten, abgebildeten Daten in einen aussagekräftigen Kontext ein. Durch regelmäßige Berichte, die Kennzahlen, Analysen und Handlungsempfehlungen kombinieren, erhalten Entscheidungsträger dann die nötige Grundlage für fundierte Entscheidungen, welche sich auf die Prozesskette und langfristig auf den gesamten Betrieb positiv auswirken können.
-
Die Kennzahlen zur Erstellung eines Reports können aus verschiedenen Quellen stammen und das „Datenfutter“ für SAP Digital Manufacturing und FORCE MES FLEX bilden, welche die Produktionsprozesse in Echtzeit steuern, überwachen und optimieren.
- Inhaltliches Reporting
- Reportings nach Zielgruppen
- Reportings nach Häufigkeit
- Reportings nach Zielsetzung
Personalzeiterfassung
-
Personalzeiterfassung ist die systematische Erfassung der Arbeitszeiten von Mitarbeitenden in einem Unternehmen. Sie dient dazu, einen genauen Überblick über die geleisteten Arbeitsstunden der einzelnen Mitarbeiter zu erhalten und damit zu einer genaueren Unternehmensplanung – ob Arbeitszeiten, Personalbedarf oder Finanzplanung durch eine präzise Kalkulation der Stückkosten.
Früher erfolgte die Zeiterfassung meist manuell, z.B. durch das Ausfüllen von Stundenzetteln. Das aber ist ein ungenaues, fehleranfälliges und vor allem zeitaufwendiges Verfahren, vor allem bei der späteren Auswertung.
Im Gegensatz dazu ist die Einführung einer digitalen, automatisierten Personalzeiterfassung wesentlich vorteilhafter.
-
Grundsätzlich gilt: Alle Arbeitszeiten müssen erfasst werden. Das bedeutet, sowohl die gesamte Arbeitszeit als auch die Dauer der Ruhepausen müssen systematisch dokumentiert werden. Diese Pflicht ergibt sich aus dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG) und dient dem Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
- Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit: Jeder Arbeitstag muss mit Beginn und Ende aufgezeichnet werden. Dies gilt auch für flexible Arbeitszeitmodelle.
- Überstunden: Jede Arbeitsleistung, die über die vereinbarte Arbeitszeit hinausgeht, muss erfasst werden. Dazu zählen auch kurzfristige Überziehungen des Arbeitstages.
- Arbeit an Sonn- und Feiertagen ist grundsätzlich verboten. Ausnahmen müssen durch den Arbeitgeber dokumentiert und die geleistete Arbeitszeit erfasst werden.
- Nachtarbeit: Auch die Zeiten der Nachtarbeit müssen gesondert erfasst werden.
Ruhepausen und Ruhezeiten: Die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen und Ruhezeiten muss durch die Arbeitszeiterfassung gewährleistet und dokumentiert sein.
Track and Trace
-
Rückverfolgbarkeit (Traceability) beschreibt die Fähigkeit, den Lebenszyklus eines Produkts oder einer Information von der Entstehung bis zum aktuellen Zeitpunkt (und umgekehrt) nachvollziehbar zu dokumentieren. Woher stammen Rohstoffe und Einzelteile eines Erzeugnisses? Welche Produktionsstätten und Maschinen waren an der Herstellung beteiligt? Vereinfacht gesagt geht es darum, die Fragen „Woher kommt das?“ und „Wohin geht es?“ präzise beantworten zu können.
-
Herkömmlich erfolgt die Rückverfolgung in Fertigungsbereichen manuelles Dokumentieren oder Aufzeichnen. Diese Methode ist jedoch sehr fehleranfälliger und zeitraubend.
Der Einsatz von digitalen Systemen zur Rückverfolgung sind deutlich effizienter. Die konkrete Umsetzung eines Traceability-Systems hängt vom jeweiligen Anwendungsbereich ab. Grundsätzlich basiert digitale Rückverfolgbarkeit auf folgenden Elementen:
- Eindeutige Identifizierung: Jedes Objekt, Bauteil oder jede Information wird mit einem eindeutigen Identifikationsmerkmal versehen – z.B. Seriennummer, Chargennummer, Barcode.
- Dokumentation: Alle relevanten Informationen entlang des Lebenszyklus´ werden erfasst und dokumentiert – z.B. Produktionsdaten, Transportwege, Lagerbedingungen.
- Verknüpfung: Die gesammelten Daten werden miteinander verknüpft, um eine durchgehende Rückverfolgung zu ermöglichen.
- Datenbank: Die Informationen werden in einer Datenbank gespeichert und können bei Bedarf abgerufen und analysiert werden.
-
Systeme zur Rückverfolgbarkeit bringen zahlreiche Vorteile. Vor Einführung sollten ein paar Punkte beachtet werden, um für genau passende Lösung zu finden.
- Analyse: Vor Einführung und Betrieb einer Traceability-Anwendung sollten eine Risiko- sowie eine Kosten-/Nutzen-Analyse erfolgen – Kosten für benötigte Hardware, Software und Personal ins Verhältnis gesetzt zu den gewünschten Zielen und möglichen Risiken.
- Komplexität: Die Auswahl eines Rückverfolgbarkeitssystemes sollte im Verhältnis zur Komplexität der Aufgaben stehen, insbesondere bei komplexen Lieferketten.
- Datenschutz und -sicherheit: Die Speicherung und Verarbeitung sensibler Daten im Rahmen der Rückverfolgung erfordert ein hohes Maß an Datenschutz und -sicherheit.
- Standardisierung: Standardisierte Schnittstellen zur Einbindung eines Rückverfolgungssystems ermöglichen den Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen und Unternehmen.
-
Track and Trace-Systeme kommen in den verschiedensten Branchen zur Anwendung – zum Beispiel
- Maschinen- und Anlagenbau: Hier dient die Rückverfolgbarkeit der Dokumentation von Fertigungsschritten und Identifizierung von mangelhaften Teilen und Chargen. Damit können Fehleranalysen effektiver durchgeführt und Wartungsplanungen optimiert werden.
- Automobile: Die Rückverfolgung von Fahrzeugteilen ermöglicht es Herstellern, im Falle von Rückrufen betroffene Fahrzeuge schnell zu identifizieren und zu reparieren.
- Luft- und Raumfahrt: Eine lückenlose Dokumentation der Herkunft und Herstellung von Flugzeugteilen sowie von Wartungsarbeiten und Ersatzteilen und die Sicherstellung der Einhaltung strenger Sicherheitsvorschriften tragen zu einer schnellen Reaktion auf Sicherheitsvorfälle bei, maximieren die Flugsicherheit und reduzieren das Haftungsrisiko.
- Spezialmaschinenbau: Die Rückverfolgbarkeit von Komponenten und Materialien für kundenspezifische Maschinen sorgt für eine effektivere Fehleranalyse und damit zu verbesserter Ersatzteillogistik.
- Medizintechnik: Die Rückverfolgung von Medizinprodukten ist unerlässlich, um die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten. Im Falle von Produktfehlern kann die Rückverfolgung lebensrettend sein.
-
Die Implementierung einer Rückverfolgbarkeit bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile:
- Höchste Transparenz: Alle Schritte im Lebenszyklus eines Erzeugnisses sind klar und nachvollziehbar dokumentiert. Dies umfasst die gesamte Lieferkette.
- Verbesserte Qualitätssicherung: Durch die Rückverfolgung von Produkten, Prozessen oder Informationen können Fehlerquellen schneller identifiziert und behoben werden. Dies ermöglicht eine gezielte Qualitätskontrolle und -verbesserung.
- Effizientes Risikomanagement: Im Falle von Problemen ermöglicht die Rückverfolgung eine schnelle und präzise Eingrenzung des betroffenen Bereichs. Durch schnelles Handeln z.B. durch Rückrufaktionen lassen sich negative Auswirkungen wie Produkthaftungsrisiken minimieren.
- Optimierte Prozesse: Die Analyse von Informationen aus der Rückverfolgung hilft Unternehmen, Prozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten.
- Gestärktes Vertrauen: Transparente Rückverfolgungssysteme schaffen Vertrauen bei Kunden und Geschäftspartnern, da sie die Nachvollziehbarkeit und Sicherheit von Produkten und Prozessen gewährleisten.
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: In vielen Branchen ist die Rückverfolgung gesetzlich vorgeschrieben, z.B. in der Lebensmittelindustrie oder im Bereich Medizinprodukte.
-
Die zunehmende digitale Vernetzung von Unternehmen und Systemen begünstigt eine umfassende und effiziente Rückverfolgung über Unternehmens- und Ländergrenzen hinweg. Durch den Austausch von Daten können alle Akteure innerhalb einer Lieferkette in Echtzeit auf Informationen zugreifen und somit schneller und effektiver auf Ereignisse reagieren.
Die Digitalisierung ermöglicht auch eine effiziente und kostengünstige Implementierung von Track and Trace-Tools. Bei ereignisgesteuerter Datenerfassung spielt die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) eine immer wichtigere Rolle.
-
Eine ereignisgesteuerte oder Event-basierte Datenerfassung in der Fertigung bedeutet, dass Daten nicht in festen Intervallen, sondern nur dann erfasst werden, wenn ein relevantes Ereignis eintritt. Dies können beispielsweise der Start oder Stop einer Maschine, die Änderung eines Parameters oder das Erreichen eines bestimmten Qualitätskriteriums sein. Die Vorteile liegen in reduziertem Datenverkehr, geringerem Ressourcenverbrauch wie Rechenleistung, flexiblerer Skalierbarkeit, verbesserter Datenqualität und letztendlich in optimierten Geschäftsprozessen.
Energiemonitoring
-
Unter dem Begriff Energiemonitoring versteht man die systematische Erfassung, Analyse und Auswertung des Energieverbrauchs. Es geht darum, Transparenz über den Energiefluss zu schaffen, Einsparpotenziale aufzudecken und die Energie- bzw. Ressourceneffizienz nachhaltig zu steigern. Im Kontext wachsender Energiepreise und der Notwendigkeit, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren sowie auch den regulatorischen Anforderungen nachzukommen –bspw. bei der Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsberichten – gewinnt das Thema Energiemonitoring zunehmend an Bedeutung.
-
Die Implementierung eines Energiemonitoring-System erfolgt in der Regel in mehreren Schritten: Zunächst sind die konkreten Ziele des Energiemonitorings festzulegen und die Anforderungen an das System zu definieren. Danach müssen alle relevanten Messpunkte im Produktionsprozess, an denen der Energieverbrauch erfasst werden soll, identifiziert werden, Sensoren und Zähler an den installierten Messpunkten registrieren den Energieverbrauch und übertragen die Daten an ein zentrales System, wie zum Beispiel MES-Lösungen von FORCAM ENISCO (E-MES, MES FLEX) oder das SAP Digital Manufacturing System für Ressourceneffizienz und Energiemonitoring. Die erfassten Daten werden zusammengeführt, analysiert und in Form von übersichtlichen Grafiken und Berichten visualisiert. Auf Basis der Analyseergebnisse kann man so konkrete Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz ableiten und umsetzen.
-
Das Energiemonitoring kann in nahezu allen Produktionsbranchen eingesetzt werden, z.B.:
- Metallverarbeitung: Überwachung des Energieverbrauchs von Öfen, Pressen, Schweißanlagen
- Kunststoffverarbeitung: Analyse des Energiebedarfs von Spritzgussmaschinen, Extrudern
- Lebensmittelindustrie: Optimierung des Energieeinsatzes bei Kühlanlagen, Backöfen, Verpackungsmaschinen
- Chemieindustrie: Überwachung des Energieverbrauchs von Reaktoren, Pumpen, Kompressoren
- Papierindustrie: Analyse des Energiebedarfs von Papiermaschinen, Trocknern
-
Das Energiemonitoring gewinnt bei den steigenden Berichtspflichten und Regularien in Bezug auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung für Unternehmen zunehmend an Bedeutung, beispielsweise im Bereich
1) CO₂-Reduktion
Ein Energiemonitoring ermöglicht die Erfassung und Analyse des Energieverbrauchs, wodurch Einsparpotenziale identifiziert und Reduktionsmaßnahmen nachgewiesen werden können. Die Dokumentation des Energieverbrauchs und die erzielten Einsparungen werden zum zentralen Bestandteil der Nachhaltigkeitsberichterstattung.
2) Social Governance und Nachhaltigkeitsberichte
Investoren und andere Stakeholder fordern zunehmend Transparenz in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG). Das Energiemonitoring liefert messbare Daten und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitsleistung zu belegen. Die Integration von Energiedaten in Nachhaltigkeitsberichte stärkt die Glaubwürdigkeit und ermöglicht den Vergleich mit anderen Unternehmen.
3) Lieferkettengesetz
Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) verpflichtet Unternehmen, auch in ihren Lieferketten auf Menschenrechte und Umweltstandards zu achten. Energiemonitoring trägt zur Transparenz und Nachverfolgbarkeit in der Lieferkette bei, indem der Ressourcenverbrauch entlang der Wertschöpfungskette erfasst wird. Unternehmen können durch energieeffiziente Produktionsprozesse ihre Nachhaltigkeitsperformance verbessern und somit die Anforderungen des LkSG erfüllen.
Vorteile von MES-Systemen:
Manufacturing Execution Systeme (MES) von FORCAM ENSICO oder das SAP Digital Manufacturing bieten Funktionen für Energiemonitoring, Leistungsanalysen und Rückverfolgbarkeit. Mit einer digitalen Erfassung und Auswertung von Energiedaten kann die Berichterstattung erleichtert und datenbasierte Entscheidungen zur Optimierung der Energieeffizienz ermöglicht werden. Staatliche Förderprogramme unterstützen Unternehmen bei der Implementierung von Energiemanagementsystemen.
-
Energiesoftware-Produkte, die in ein Energie- oder Umweltmanagementsystem integriert werden und zur Steigerung der Energieeffizienz beitragen, sind in Deutschland durch das BAFA (Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft) förderfähig. Die Förderung umfasst
- Erwerb, Installation und Inbetriebnahme von Energiemanagement-Software
- Einweisung bzw. Schulung des Personals im Umgang mit der Software
- Bei Cloud-basierter Software: die vollständigen externen Nutzungskosten
Private Unternehmen mit einer Betriebsstätte oder Niederlassung in Deutschland können die Förderung in Anspruch nehmen. Die maximale Förderung beträgt laut BAFA 15 Millionen
Euro pro Investitionsvorhaben bei einer Förderquote von bis zu 40 % der förderfähigen Investitionskosten.
FORCAM ENISCO informiert gerne ausführlich über die bestehenden Fördermöglichkeiten.
Maschinendatenerfassung
-
Die Digitalisierung hält Einzug in die Produktionshallen – und eine gewichtige Rolle spielt dabei die Maschinendatenerfassung (MDE). Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Welche Daten werden erfasst und welchen Nutzen hat das Ganze? Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit den MDE-Lösungen von FORCAM ENISCO „zum Beben“ bzw. die Prozesse in Ihrem Maschinenpark revolutionieren können.
Bei der MDE geht es – vereinfacht gesagt – darum, Informationen direkt von Maschinen und Anlagen zu sammeln und digital verfügbar zu machen. Anstatt mühsam Daten per Hand in Tabellen einzutragen, werden sie bei der Maschinendatenerfassung automatisch und in Echtzeit erfasst. Das können Informationen, beispielsweise über den Produktionsfortschritt, den Energieverbrauch, den Materialfluss oder den Zustand der Maschine selbst sein.
-
Maschinendaten können direkt aus der Steuerung abgegriffen werden. Hier gibt es eine Vielzahl von Anbietern und unterschiedliche Kommunikationsprotokolle. Aus den Signalen wandelt AC4DC ein Zustand ab, bspw. Maschine läuft/läuft nicht und gibt dies in dem nötigen Standard weiter. Die Normierung (Interpretation) der Daten ist ein Mehrwert, den nicht jeder Anbieter liefern kann. Das heißt, die Interpretation muss nicht zu einem späteren Zeitpunkt gemacht werden, und somit ist es weniger komplex.
Sensoren können zusätzlich genutzt werden, Steuerungen sind aber an den meisten Maschinen vorhanden und aus diesen lassen sich bereits viele Daten auslesen.
-
Die Bandbreite an erfassbaren Maschinendaten ist enorm und hängt natürlich von der jeweiligen Maschine und den Zielen der Datenerfassung ab. Grundsätzlich lassen sich die Daten in verschiedene Kategorien einteilen:
1) Betriebsdaten:
- Produktionsdaten: Anzahl produzierter Teile, Produktionsgeschwindigkeit, Ausschussrate, Laufzeiten/Stillstandzeiten etc.
- Prozessdaten: Temperatur, Druck, Drehzahl, Durchflussmenge etc.
- Zustandsdaten: Vibrationen, Geräusche, Temperatur der Bauteile etc.
2) Energiedaten:
- Stromverbrauch
- Druckluftverbrauch
- Wasserverbrauch
3) Qualitätsdaten:
- Maßhaltigkeit der Produkte
- Oberflächenbeschaffenheit
- Fehlererkennung
4) Materialdaten:
- Materialverbrauch
- Materialfluss
- Chargennummern
Das sind nur einige Beispiele für die Maschinendatenerfassung, die zeigen sollen, wie viele dieser Parameter Einfluss auf die Produktivität haben können und wie viele Möglichkeiten es gibt, anhand genauer Erfassung diese zu optimieren – und vor allem wie wichtig ein MDE-System sein kann.
-
Die kontinuierliche Erfassung und Auswertung von Maschinendaten bieten den Unternehmen enorme Optimierungspotenziale und Wettbewerbsvorteile:
1) Gesteigerte Transparenz & Effizienz
- Echtzeit-Einblicke: Maschinendatenerfassung ermöglicht eine lückenlose Überwachung der Produktionsprozesse in Echtzeit. So erhält man einen umfassenden Überblick über die Leistung einzelner Maschinen, den Materialfluss und die gesamte Anlageneffektivität (OEE).
- Optimierte Produktionsplanung: Anhand der gesammelten Daten können Produktionsprozesse besser geplant und Engpässe frühzeitig erkannt und behoben werden.
- Reduzierte Stillstandzeiten: Durch die Überwachung des Maschinenzustands können Wartungsarbeiten vorausschauend geplant werden (Predictive Maintenance). Ungeplante Stillstände, die hohe Kosten verursachen, werden so minimiert.
2) Gesteigerte Produktqualität
- Kontinuierliche Qualitätskontrolle: Durch die Überwachung relevanter Parameter während des gesamten Produktionsprozesses können Abweichungen von der Norm frühzeitig erkannt und korrigiert werden.
- Lückenlose Rückverfolgbarkeit: Im Falle von Qualitätsproblemen ermöglicht die Maschinendatenerfassung eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Produktionsdaten und Chargen.
3) Reduzierte Kosten
- Effizientere Ressourcennutzung: Durch die Optimierung von Produktionsprozessen und die Reduzierung von Ausschuss wird der Ressourcenverbrauch (Material, Energie) minimiert.
- Geringere Wartungskosten: Vorausschauende Wartung ermöglicht es, Wartungseinsätze zu optimieren und kostspielige ungeplante Stillstände zu vermeiden.
4) Gesteigerte Flexibilität & Skalierbarkeit
- Schnelle Reaktion auf Marktveränderungen: Maschinendatenerfassung ermöglicht eine flexible und agile Produktion, die schnell auf neue Anforderungen und Marktveränderungen reagieren kann.
- Einfache Skalierbarkeit: Die Datenerfassung lässt sich jederzeit an neue Maschinen und Anlagen anpassen und flexibel erweitern.
-
AC4DC von FORCAM ENISCO ist eine hochverfügbare und sichere Konnektivitätslösung der nächsten Generation für die Produktion. Das cluster- und cloudfähige MDE-Tool sammelt Daten von Maschinen und stellt sie in Echtzeit bereit, um datenbasierte Entscheidungen zu ermöglichen:
- Einfache Installation und Bedienung: Intuitive Benutzeroberfläche und einfache Konfigurationsprozesse ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme und einfache Bedienung.
- Skalierbarkeit: AC4DC ist für Produktionsstätten jeder Größe geeignet und kann mit dem Wachstum des Unternehmens skalieren.
- Umfassende SPS-Unterstützung: AC4DC unterstützt eine breite Palette von Industriemaschinen und -geräten. Vorgefertigte Treiber und Konnektoren sorgen für eine nahtlose Integration.
- Grundlage für Echtzeit-Datenanalyse: AC4DC bietet robuste Echtzeit-Datenanalysefunktionen, die es Anwendern ermöglichen, schnell fundierte Entscheidungen zu treffen.
- Hervorragender Support: FORCAM ENISCO bietet umfassenden Support, um sicherzustellen, dass Benutzer bei Bedarf sachkundige und reaktionsschnelle Unterstützung erhalten.
- Schnelle und flexible Implementierung: Standardisierte Vorlagen und ein zentraler Kontrollpunkt beschleunigen die Maschinenanbindung und den Rollout.
- Stabile und unterbrechungsfreie Datenversorgung:
- Fail-Safe Datenerfassung durch Cluster-Technologie für stabile Konnektivität
- Schnelle Wiederherstellung der Daten nach Ausfallzeiten
- Kompensation von Kommunikationsausfällen zu anderen Softwaresystemen
- Verbesserte Datensouveränität und Cybersicherheit:
- Verschlüsselte Datenströme für kontrollierte und sichere Maschinendatenerfassung
- Cyber-sicher designt für erhöhte Robustheit gegenüber Cyberangriffen
Dokumentenmanagement
-
Das Dokumentenmanagement beschreibt die effiziente und systematische Erfassung, Verwaltung, Speicherung, Bereitstellung und Archivierung von Dokumenten – und das über den gesamten Lebenszyklus des entsprechenden Produkts oder Prozesses hinweg. In der heutigen Zeit handelt es sich dabei meist um digitales Dokumentenmanagement, das den Einsatz von Softwarelösungen und digitalen Archiven umfasst.
Die papierlose Fertigung ist das zentrale Ziel von digitalem Dokumentenmanagement. Es ermöglicht den Übergang von papierbasierten Prozessen zu digitalen Workflows und bildet so das Fundament für die smarte Fabrik.
-
Gesteigerte Effizienz und Produktivität
- Schnellere Suche & Wiederauffindbarkeit: Durch zentrale Ablage, Metadaten und Suchfunktionen lassen sich Dokumente schnell und einfach wiederfinden.
- Automatisierte Prozesse: Workflows automatisieren wiederkehrende Aufgaben und reduzieren manuellen Aufwand, z.B. bei der Freigabe oder Rechnungsprüfung.
- Verbesserte Zusammenarbeit: Gleichzeitige Bearbeitung, Versionierung und Kommentarfunktionen erleichtern die Zusammenarbeit an Dokumenten, auch im Team.
Reduzierte Kosten
- Geringerer Papierverbrauch & Lagerkosten: Die Digitalisierung von Dokumenten minimiert den Papierverbrauch und die Kosten für Lagerung und Archivierung.
- Weniger Verwaltungsaufwand: Automatisierte Prozesse und optimierte Workflows reduzieren den manuellen Verwaltungsaufwand.
- Vermeidung von Fehlern & Doppelarbeit: Zentrale Datenhaltung und Versionierung minimieren Fehlerquellen und vermeiden doppelte Arbeit.
Verbesserte Compliance & Sicherheit
- Einhaltung gesetzlicher Vorgaben: Archivierungs- und Löschfristen können automatisiert eingehalten werden, um die Compliance zu gewährleisten.
- Kontrolle über sensible Daten: Zugriffskontrolle und Berechtigungen schützen sensible Daten vor unberechtigtem Zugriff.
- Nachvollziehbarkeit & Revisionssicherheit: Versionierung und Historie ermöglichen die Nachverfolgung von Änderungen und gewährleisten die Revisionssicherheit.
Gesteigerte Kundenzufriedenheit
- Schnellere Reaktionszeiten: Schnelle Dokumentenfindung und optimierte Workflows ermöglichen schnellere Reaktionszeiten auf Kundenanfragen.
- Verbesserter Kundenservice: Der schnelle Zugriff auf alle relevanten Informationen ermöglicht einen besseren und effizienteren Kundenservice.
Feinplanung
-
Die Feinplanung –auch Produktionsfeinplanung – ist ein essenzieller Prozess des Produktionsmanagements und beschäftigt sich mit der kurzfristigen Planung und Steuerung der Produktionsprozesse. Im Gegensatz zur Grobplanung, die sich mit längerfristigen Zielen und strategischen Entscheidungen befasst, fokussiert die Feinplanung auf eine tagesaktuelle und detaillierte Planung und Organisation der Produktion. Ziel der Feinplanung ist es, die verfügbaren Ressourcen für jeden Auftrag wie Maschinen, Material und Personal optimal einzusetzen, um eine termingerechte und effiziente Produktion zu gewährleisten.
-
Die Feinplanung umfasst eine Vielzahl von Aufgaben, die eng miteinander verzahnt sind. Dazu gehören:
1) Ressourcenplanung:
- Maschinenbelegung: Detaillierte Planung der Maschinenbelegung unter Berücksichtigung von Rüstzeiten, Wartungsintervallen und Kapazitätsgrenzen.
- Personaleinsatzplanung: Zuordnung der Mitarbeiter zu den einzelnen Arbeitsgängen unter Berücksichtigung von Qualifikationen, Verfügbarkeit und Arbeitszeitmodellen.
- Materialdisposition: Sicherstellung der Materialverfügbarkeit für die geplanten Produktionsaufträge zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Menge.
2) Ablaufplanung:
- Reihenfolgeplanung: Festlegung der optimalen Reihenfolge der Produktionsaufträge auf den einzelnen Maschinen und Anlagen, um Durchlaufzeiten zu minimieren und Leerlaufzeiten zu vermeiden.
- Losgrößenplanung: Bestimmung der optimalen Losgröße für die einzelnen Produktionsaufträge unter Berücksichtigung von Rüstkosten, Lagerkosten und Kapazitätsauslastung.
- Terminplanung: Festlegung von Start- und Endterminen für die einzelnen Produktionsaufträge und Arbeitsvorgänge (AVO) unter Berücksichtigung von Durchlaufzeiten, Lieferterminen und Ressourcenverfügbarkeit.
3) Produktionssteuerung:
- Nutzung der Auftragsdaten aus dem ERP: Essenziell, um detaillierte Informationen über die zu produzierenden Aufträge mit Zieldaten und Prioritäten zu erhalten.
- Auftragsfreigabe: Freigabe der geplanten Produktionsaufträge zur Ausführung in der Produktion.
- Fortschrittskontrolle: Überwachung des Produktionsfortschritts und Identifikation von Abweichungen vom Plan.
- Eingriffssteuerung: Ergreifen von Korrekturmaßnahmen bei Abweichungen vom Plan, z.B. Anpassung der Reihenfolgeplanung oder Priorisierung von dringenden Aufträgen.
-
Von einer verbesserten Zusammenarbeit und Kommunikation bis hin zu einer höheren Rentabilität und Kundenzufriedenheit: Die Feinplanung bietet zahlreiche Vorteile, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre strategischen Ziele zu erreichen und sich in einem dynamischen Marktumfeld zu behaupten. Signifikante Pluspunkte sind:
- Kürzere Durchlaufzeiten: Die Minimierung von Durchlaufzeiten durch Vermeidung von Leerlaufzeiten und eine optimierte Reihenfolgeplanung führen zu einer schnelleren Fertigstellung der Produkte.
- Geringere Lagerbestände: Durch die bedarfsgerechte Materialdisposition und die Vermeidung von Überproduktion werden die Lagerbestände reduziert und die Lagerkosten gesenkt.
- Höhere Kapazitätsauslastung: Die optimale Auslastung der Produktionsressourcen führt zu einer höheren Produktivität und Wirtschaftlichkeit.
- Termingerechte Lieferung: Durch eine optimale Planung und Steuerung der Produktionsprozesse wird die Einhaltung von Lieferterminen sichergestellt.
- Verstärkte Kundenbindung: Die zuverlässige Einhaltung von Lieferterminen stärkt die Kundenbindung und verbessert die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.
-
Die Feinplanung ist ein komplexer Prozess, der mit zahlreichen Herausforderungen verbunden ist. Oft können unerwartete Probleme auftauchen, die Improvisation bei der Planung benötigen – z.B. ein Lieferant springt ab, ein wichtiger Mitarbeiter wird krank oder ein unvorhergesehener Kostenpunkt taucht auf. Ohne die nötige Transparenz und Kontrolle ist es daher kaum möglich, tagesaktuelle Produktionspläne zu erstellen.
Umso wichtiger ist es, durch flexible Feinplanung mit entsprechenden digitalen Instrumenten die Möglichkeit zu haben, verschiedene Szenarien durchspielen zu können, um immer auch einen „Plan B“ in der Hinterhand zu haben.
Die größten Herausforderungen in der Feinplanung:
- Dynamische Umgebung: Kurzfristige Änderungen von Kundenwünschen, Materialengpässen oder Maschinenausfällen erfordern eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Planung.
- Datenqualität: Die Qualität der Planung hängt maßgeblich von der Qualität der zugrundeliegenden Daten ab. Ungenaue oder unvollständige Daten können zu Fehlplanungen und Ineffizienzen führen.
- Komplexität: Die zunehmende Variantenvielfalt, die Verkürzung der Produktlebenszyklen und die Globalisierung der Lieferketten erhöhen die Komplexität von Fertigungen insgesamt – und damit auch der Feinplanung.
Nicht zu vergessen, der menschliche Faktor: Die Feinplanung ist nicht nur eine technische Aufgabe, sondern erfordert auch die Einbeziehung der Mitarbeiter durch fortwährenden Austausch und offene Kommunikation gegenseitiger Erfahrungswerte.
-
Für die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben der Feinplanung stehen verschiedene Methoden und Werkzeuge zur Verfügung. Dazu gehören:
- Gantt-Diagramme: Grafische Darstellung von Produktionsaufträgen und deren Zeitplänen.
- Netzplantechnik: Darstellung von komplexen Projekten mit Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Arbeitsgängen.
- Prioritätsregeln: Festlegung von Regeln für die Reihenfolgeplanung, z.B. „kürzeste Operationszeit“ oder „frühester Fertigstellungstermin“.
- Simulation: Nachbildung des Produktionssystems an digitalen Endgeräten (Tablets etc.), um verschiedene Planungsszenarien zu testen und die optimale Lösung zu finden.
- Softwarelösungen: ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) mit integrierten Modulen für die Feinplanung (z.B. FE Detailed Scheduling oder SAP REO).
Zur Bewältigung der Komplexität der Feinplanung bieten unterschiedliche Systeme eine Vielzahl von Funktionen, die die Feinplanung unterstützen, z.B.:
- Grafische Plantafeln: Zur Visualisierung des Produktionsplans und zur interaktiven Planung der Fertigungsaufträge.
- Automatische Reihenfolgeplanung: Algorithmen, die die optimale Reihenfolge der Fertigungsaufträge unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien ermitteln.
- Materialbedarfsplanung: Funktionen zur Berechnung des Materialbedarfs und zur Überwachung der Materialverfügbarkeit.
- Kapazitätsplanung: Funktionen zur Berechnung der Auslastung von Maschinen und Personal zur Identifizierung von Engpässen.
-
Um die Aufgaben effizient zu erfüllen, bedarf es einer durchgängigen Integration von Maschinen, MES- und ERP-System. Durch die Maschinendatenerfassung (MDE) und Betriebsdatenerfassung (BDE) stehen die nötigen Echtzeitinformationen aus der Fertigung zur Verfügung.
Mit Feinplanungs-Instrumenten wie FE Detailed Scheduling von FORCAM ENISCO oder SAP REO verfügen Sie über eine Echtzeit-Transparenz: Die Produktionsleitung kann den Plan jederzeit einsehen, den Produktionsstatus mit allen verfügbaren Ressourcen im Blick behalten und potenzielle Engpässe sowie kurzfristige Störungen sofort erkennen.
3D-Visualisierung
-
Visualisierung heißt, komplexe Informationen und Prozesse mithilfe von visuellen Hilfsmitteln darzustellen, um sie leicht verständlich und nutzbar zu machen. Dabei kommen verschiedene Medien und Methoden zum Einsatz, die auf die spezifischen Anforderungen der Produktion abgestimmt sind.
-
2D- und 3D-Visualisierungen spielen insbesondere in verschiedenen Bereichen von Fertigungsunternehmen eine wichtige Rolle und tragen maßgeblich zur Effizienzsteigerung und Qualitätssicherung bei.
2D-Visualisierung
2D-Visualisierungen bieten eine zweidimensionale Darstellung von Objekten und Prozessen.
- Technischen Zeichnungen: Sie bilden das Fundament der Fertigung und definieren Produkte und Bauteile präzise in Bezug auf Geometrie, Abmessungen, Toleranzen und Oberflächenbeschaffenheit.
- Schaltplänen: In der Elektrotechnik und Elektronikfertigung sind Schaltpläne essenziell, um die Verdrahtung von Bauteilen und den Signalfluss zu dokumentieren.
- Flussdiagrammen: Sie veranschaulichen komplexe Prozesse und Abläufe in der Produktion und helfen dabei, Engpässe und Optimierungspotentiale zu identifizieren.
- Layoutplanungen: 2D-Grundrisse und Fabriklayouts helfen bei der Planung von Produktionslinien, der Anordnung von Maschinen und der Optimierung von Materialflüssen.
- Leistungs- und Verbrauchsanalysen: 2D-Charts zu Maschinenleistungen oder Energieverbräuchen in Echtzeit sowie in Zeitreihen helfen Fabrikteams, wiederkehrende Mängel abzustellen und nachhaltige Optimierungen vorzunehmen.
- Eindeutigkeit und Präzision: 2D-Abbildungen basieren auf genormten Symbolen und Darstellungsformen, die global verständlich sind und Fehlinterpretationen minimieren.
- Relativ einfache Erstellung: 2D-Darstellungen können mit vergleichsweise geringem Aufwand mithilfe von CAD-Programmen erstellt und modifiziert werden.
- Geringer Speicherbedarf: Im Vergleich zu 3D-Modellen benötigen 2D-Dateien deutlich weniger Speicherplatz und lassen sich einfacher verwalten.
3D-Visualisierung
3D-Visualisierungen bieten eine realitätsnahe, dreidimensionale Darstellung von Objekten und Prozessen und eröffnen der Fertigungsunternehmen neue Möglichkeiten in Bezug auf
- Produktdesign und -entwicklung: 3D-Modelle ermöglichen die virtuelle Konstruktion von Produkten und Bauteilen. Unterschiedliche Designvarianten können einfach erstellt, verglichen und auf ihre Funktionalität simuliert werden.
- Virtuelle Inbetriebnahme: Gesamte Produktionsanlagen können virtuell aufgebaut und simuliert werden, bevor die reale Inbetriebnahme erfolgt. Dadurch lassen sich Planungsfehler frühzeitig erkennen und beheben.
- Roboterprogrammierung: Die Programmierung von Industrierobotern wird durch 3D-Simulationen vereinfacht und sicherer. Roboterbewegungen und Greifprozesse können offline programmiert und optimiert werden, bevor sie in der realen Umgebung eingesetzt werden.
- Schulung und Training: 3D-Modelle und -Simulationen bieten eine effektive Möglichkeit, Mitarbeiter an neuen Maschinen und Prozessen zu schulen. So kann der Umgang mit komplexen Anlagen gefahrlos trainiert werden.
- Verbessertes räumliches Verständnis: Komplexe Geometrien und Zusammenhänge werden durch 3D-Visualisierungen intuitiv erfassbar und erleichtern die Kommunikation zwischen den Beteiligten.
- Früherkennung von Fehlern: Durch die Simulation von Prozessen und Abläufen können potenzielle Fehler und Kollisionen bereits in der Planungsphase identifiziert und behoben werden.
- Effizientere Prozesse: Die virtuelle Inbetriebnahme und Roboterprogrammierung mithilfe von 3D-Simulationen verkürzen die Rüstzeiten und erhöhen die Produktivität.
- Verbesserte Kommunikation: 3D-Modelle und -Animationen ermöglichen eine anschauliche und verständliche Kommunikation, auch gegenüber Laien.
-
Die Shopfloorlösung E-MES von FORCAM ENISCO ermöglicht die Erstellung von digitalen Zwillingen von Produktionsanlagen in 2D oder 3D.
Funktionsweise:
- Objekterstellung: Die Visualisierung basiert auf 3D-Objekten, die entweder aus der Standardbibliothek importiert oder im Objekteditor selbst erstellt werden können.
- Szenenaufbau: Durch die Aufbereitung von Objekten zu Szenen, kann die reale Produktionsanlage komplett virtuell abgebildet werden.
- Datenverknüpfung: Die Objekte werden mit Produktionsdaten verknüpft, sodass ein Echtzeitmodell der Anlage entsteht. So lassen sich beispielsweise Materialflüsse, Maschinenzustände und Prozessfortschritte visualisieren.
Cloud MES
SAP Digital Manufacturing (SAP DM)
-
SAP Digital Manufacturing (DM) ist eine cloudbasierte Lösung für Manufacturing Execution Systems (MES), die Fertigungsunternehmen ermöglicht, ihre Produktionsprozesse in Echtzeit zu überwachen und zu optimieren. Sie integriert fortschrittliche Technologien wie IoT und KI, um intelligente, datengetriebene Entscheidungen zu unterstützen. Durch die nahtlose Integration mit anderen SAP-Lösungen bietet sie eine durchgängige Prozess- und Datenintegration. Diese Lösung hilft Unternehmen, effizienter und nachhaltiger zu produzieren und gleichzeitig auf Veränderungen in der Nachfrage flexibel zu reagieren.
-
Die Beratung erfolgt auf einem systemischen Ansatz, welcher Sie erfolgreich durch jede Phase Ihres Projekts führt, bis hin zur vollständigen Implementierung der SAP Digital Manufacturing. Dazu gehört auch die Befähigung aller Stakeholder.
-
Als SAP Silver Partner bieten wir mit unseren Konnektivitätslösungen eine direkte Kommunikation mit SAP Digital Manufacturing (SAP DM). Damit können Sie Ihren Maschinenpark (Brownfield und Greenfield) in Rekordzeit anbinden und vollständige Transparenz über Ihr Produktionsgeschehen gewinnen. Zuverlässig und sicher.
SAP Resource Orchestration (SAP REO)
-
SAP Resource Orchestration (SAP REO) nutzt Automatisierung und KI-Technologien, um die Schichtplanung in der Fertigung zu optimieren und effizienter zu gestalten.
Vorteile
- Erhöhte Produktionseffizienz reduziert Leerlaufzeiten
- Verbesserte Ressourcenauslastung vermeidet Engpässe und Überlastungen
- Schnelle Reaktionsfähigkeit sichert die Kontinuität der Produktion
- Höhere Produktqualität reduziert Fehler und hält Standards ein
- Kosteneinsparungen durch effiziente Ressourcennutzung und weniger Verschwendung
-
SAP DM REO nutzt die Möglichkeiten der Automatisierung und der KI-Technologie, um die Schichtplanung zu optimieren und effizienter zu gestalten. Dieses innovative Tool hilft Produktionsleitern in der Fertigung, potenzielle Ineffizienzen zu erkennen, sich schnell auf unerwartete Ereignisse wie Maschinen- oder Mitarbeiterausfälle einzustellen und die Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeiter zu priorisieren, um den Durchsatz zu optimieren – und das alles bei garantiert maximaler Effizienz.
-
Ja, in SAP Resource Orchestration (SAP REO) können Pläne manuell angepasst werden. Diese Funktionalität ermöglicht es den Benutzern, spezifische Anforderungen und Veränderungen in ihrer IT-Infrastruktur flexibel zu berücksichtigen. Manuelle Anpassungen können beispielsweise notwendig sein, um auf unerwartete Ereignisse zu reagieren oder um maßgeschneiderte Optimierungen durchzuführen.
Die manuelle Anpassung von Plänen kann verschiedene Aspekte umfassen, wie etwa das Ändern von Zeitplänen, das Zuweisen von Ressourcen oder das Modifizieren von Workflows. SAP REO bietet hierfür eine benutzerfreundliche Oberfläche und umfangreiche Tools, um sicherzustellen, dass die Anpassungen effizient und effektiv durchgeführt werden können.
SAP Digital Manufacturing: Execution
-
Mit SAP Digital Manufacturing: Execution planen, steuern und automatisieren Sie Prozesse und Ressourcen, um die Effizienz, Qualität und Produktivität in der Fertigung zu verbessern.
Vorteile
- Echtzeit-Transparenz über die Produktionsprozesse
- Rückverfolgbarkeit von Rohmaterial bis zum Fertigprodukt
- Verbesserte Produktionsplanung und -steuerung
- Gesteigerte Flexibilität und Reaktionsfähigkeit
- Optimale Ressourcenauslastung
-
Das Production Operator Dashboard (POD) ist die Hauptschnittstelle zwischen dem Bediener in der Fertigung und der Anwendung, die die Fertigungsdaten enthält.
-
Die Werkerführung in SAP Digital Manufacturing ist ein leistungsstarkes Tool, das sicherstellt, dass Produktionsmitarbeiter optimal durch den Fertigungsprozess geführt werden. Sie bietet eine benutzerfreundliche und effiziente Methode, um sicherzustellen, dass Aufträge korrekt und rechtzeitig ausgeführt werden. Hier ist eine Beschreibung, wie diese Werkerführung funktioniert:
Rechtzeitige Benachrichtigungen über Änderungen
Mit SAP DM werden Mitarbeiter rechtzeitig über Änderungen in der Bestellung oder Konfiguration informiert. Dies gewährleistet, dass die neuesten Anweisungen und Anforderungen immer zur Verfügung stehen und sofort umgesetzt werden können. Das System sendet automatische Benachrichtigungen und Updates an die mobilen Geräte der Mitarbeiter, sodass keine Informationen übersehen werden.
Klare Arbeitsanweisungen
SAP DM bietet klare und detaillierte Arbeitsanweisungen, die Schritt für Schritt durch den Fertigungsprozess führen. Diese Anweisungen sind direkt auf den mobilen Geräten der Mitarbeiter verfügbar, wodurch Missverständnisse und Fehler minimiert werden. Die Anweisungen können Text, Bilder und Videos umfassen, um sicherzustellen, dass jeder Arbeitsschritt korrekt und verständlich erklärt wird.
Einfache Auftragserfassung und -bearbeitung
Mitarbeiter können Aufträge einfach über ein mobiles Gerät empfangen, kommissionieren und abschließen. SAP DM ermöglicht es, Aufträge direkt auf dem Shopfloor zu verwalten, ohne dass Papierdokumente erforderlich sind. Mit der mobilen App können Mitarbeiter:
- Aufträge empfangen und sofort beginnen
- Die benötigten Materialien und Werkzeuge identifizieren und kommissionieren
- Jeden Arbeitsschritt dokumentieren und abschließen
- Den Fortschritt in Echtzeit verfolgen
Diese Funktionen verbessern die Effizienz und Genauigkeit der Auftragsabwicklung und sorgen dafür, dass die Produktion reibungslos und ohne Unterbrechungen läuft.
SAP Digital Manufacturing: Insights
-
Mit SAP Digital Manufacturing erhalten Sie smarte Reports und Analysen zu Ihren globalen Betriebsabläufen.
- Globale und werksspezifische Fertigungs-Transparenz: Werke global benchmarken, bewährte Verfahren an allen Standorten für höhere Produktivität nutzen
- Vorkonfigurierte Reports und Analysen mit Standard-KPIs: Schnelle und präzise Analysen erhalten, das Analysespektrum durch individuelle KPIs nach Bedarf erweitern
- Kontinuierliche Verbesserung durch fundierte Daten: Daten für fundierte Entscheidungen erhalten, kontinuierliche Verbesserungsprozesse (KVP) einleiten
-
- Einblicke auf globaler Ebene und auf Werksebene
- KPI-Analysen
- Gesamtanlageneffektivität (OEE)
- Entwerfen und Anpassen von Dashboards & Reports
- Analyse der schichtbasierten Produktion
On-Premise MES
MES FLEX
-
Mit MES FLEX bieten wir fertigenden Unternehmen eine schlüsselfertige und frei erweiterbare Plattform-Lösung für die Ära des industriellen Internets der Dinge (IIoT). In der multicloudfähigen Lösung enthalten sind
(a) umfassende Konnektivität für Shopfloor und Topfloor, also die Anbindung heterogener Maschinenparks sowie die Vernetzung mit dem Topfloor (Unternehmensleitebene),
(b) ein semantisches Produktionsdatenmodell als digitaler Zwilling der Produktion sowie
(c) offene Web-Schnittstellen zur freien Komposition und Kollaboration von unternehmenseigenen und externen IT-Systemen.
-
Kunden erhalten mit der Lösung MES FLEX volle Transparenz in der Fertigung, höhere Effizienz im gesamten Unternehmen sowie größtmögliche Freiheit und Flexibilität in der IT-Architektur.
- Volle Transparenz im Shopfloor entsteht durch umfängliche Konnektivität: Maschinen unterschiedlicher Jahrgänge und Hersteller sowie die ERP-Ebene können leichtgängig angebunden und vernetzt werden. Dazu kommen Plug-ins und Templates für unterschiedlichste Maschinentypen und -jahrgänge zum Einsatz.
- Höhere Effizienz durch schlüsselfertige Nutzbarkeit: Unternehmen können sofort loslegen, ihre Produktivität zu steigern. Ein Hochgeschwindigkeitsrechner erstellt den digitalen Zwilling der Produktion. Dieses Produktionsdatenmodell kann mit vorkonfigurierten MES-Anwendungen mit mehr als 70 Analyse- und Report-Funktionen sofort zur Effizienzsteigerung genutzt werden.
- Größte Flexibilität für Komposition und Kollaboration von IT-Systemen: Die Lösung ist frei erweiterbar, Kunden können mit eigenen und externen Systeme und Anwendungen individuelle IT-Architektur schaffen – durch die offene Programmier-Schnittstelle FORCE Bridge API. Zudem sind hybride Infrastrukturen aus Edge- und Cloud-Computing möglich.
-
Konnektivität und Digitaler Zwilling: Eine umfängliche Konnektivität für Shopfloor und Topfloor wird durch standardisierte Maschinen-Plug-ins und ERP-Adapter sichergestellt. Herzstück der Plattform ist eine hauptspeicher-basierte Rule Engine zur Geschäftsprozess-Modellierung und zur Datenvalidierung in Echtzeit. Die Rule Engine enthält einen semantischen Datenlayer, der Big Data in Smart Data verwandelt und so den digitalen Zwilling der Produktion virtuell am Computer generiert – zentrale Voraussetzung für höhere Transparenz und Effizienz.
Schlüsselfertige MES Apps (Manufacturing Execution System): MES FLEX bietet vorinstallierte MES-Anwendungen wie Rückverfolgung (Track & Trace), Leistungsanalyse (Berichte, Visualisierungen, Alarmierungen), Fertigungsdatenmanagement (Produktionsdaten, Auftragsdaten, DNC), Energiemonitoring (Überblick über alle Verbrauchswerte), Feinplanung und -steuerung (Aufträge, Kapazitäten, dynamische Terminierung)
Offene Web-Schnittstellen: Über die offene Programmier-Schnittstelle FORCE Bridge API können jedwede Drittsysteme integriert werden. Die Lösung FORCE MES FLEX bietet dazu vorinstallierte marktführende Apps von FORCAM Partnern zum Beispiel für Künstliche Intelligenz (KI), Werkzeugdatenmanagement (TDM), Qualitätssicherung (CAQ) und Produkt Lifecycle Management (PLM).
-
Für die ERP-Systemintegration sind Adapter verfügbar, um eine bidirektionale Kommunikation zwischen MES FLEX und Ihrem ERP-Backend zu ermöglichen.
Wenn Kunden kein SAP haben, gibt es die Möglichkeit, dass das ERP-System des Kunden über die offene Schnittstelle interagiert. Wenn die Nutzung unserer Technologie nicht von dem ERP-Anbieter unterstützt wird, können wir einen XML-basierten Datenaustausch organisieren, der in der Regel mit jedem ERP-System notwendig ist und auf der ERP-Seite entsprechende Anwendungsentwicklungen voraussetzt.
-
Die Rule-Engine arbeitet In-Memory-basiert in Kombination mit Complex Event Processing (CEP). Die Kombination aus In-Memory-Computing und CEP ist ein Alleinstellungsmerkmal von FORCAM: Sie bringt die benötigte Echtzeit-Verarbeitung von Daten in Millisekunden. Nur mit einer In-Memory-basierten Datenhaltung, also einer Datenhaltung im Hauptspeicher, kann die für Echtzeitberechnung notwendige Geschwindigkeit im Bereich von Millisekunden erreicht werden.
-
Die Lösung MES FLEX enthält die erste offene Web-Schnittstelle für digitale Fertigung mit dem Namen FORCE Bridge API. Mit ihr können Kunden und Partner über sogenannte REST APIs mit der FORCAM Plattform frei interagieren. FORCAM hat die Schnittstelle FORCE Bridge API zusammen mit Industrie und Wissenschaft 2018 entwickelt, patentiert und öffentlich publiziert.
Damit stellt FORCAM Kunden und Partnern offene Programmier-Schnittstellen auf Anwendungsebene zur Verfügung: Über diese REST APIs können Kunden oder Partner jedwede Information aus der Fertigung über die Plattform abrufen und entsprechende Informationen in die Plattform zurückschreiben. Der Zugang zur FORCAM Plattform via REST API ist lizenzfrei, um den Zugang barrierefrei zu gestalten. Wenn ein Kunde die Anwendungen selber einführen und die Maschinenanbindung selbstständig vornehmen möchte, bietet die FORCAM Academy entsprechende Schulungen an.
-
FORCAM FORCE Bridge API™ – Die offene API für die intelligente Fertigung. Nachstehend finden Sie alle verfügbaren SDKs, einige Anwendungsbeispiele und das Handbuch.
E-MES
-
Die ENISCO by FORCAM GmbH ist ein global agierendes Softwareunternehmen mit dem Ziel, die Fertigung intelligenter, effizienter und flexibler zu machen und die Smart Factory Wirklichkeit werden zu lassen. Als Tochtergesellschaft der FORCAM GmbH hat ENISCO über 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von Manufacturing Execution Systemen (MES), Supervisory Control and Data Acquisition Systemen (SCADA) sowie Human Maschine Interface Lösungen (HMI). Die Softwarelösungen von ENISCO optimieren Fertigungen in unterschiedlichsten Branchen, angefangen mit Wasseraufbereitungsanlagen, über vollautomatisierte Logistikzentren, bis hin zu kompletten Automobillackierwerken. Aktuell ist ENISCO in Deutschland, Indien und China mit 50 Experten vertreten, deren Passion es ist neue Technologien zu entwickeln und den Fertigungsprozess unserer Kunden zu optimieren.
-
Spezialität des Unternehmens ist das Produktionsleitsystem „E-MES“. Das modulare Manufacturing Execution System von ENISCO bietet eine maßgeschneiderte Lösung für jeden Kunden. Die Lösung vernetzt die Fabrik sowohl horizontal über den gesamten Fertigungsprozess als auch vertikal über alle Prozessebenen hinweg. E-MES gewährleistet aufgrund seiner integrierten Datenerfassung, Analyse und Darstellung durchgehend transparente Produktions- und Logistikprozesse und bildet damit die Basis für jede Industrie 4.0 Lösung.
-
Neben der Software bietet ENISCO umfassende Dienstleistungen an:
- Analyse und Beratung
- Konzeption und Planung
- Kundenspezifische Entwicklung
- Umfassende Projektsteuerung
- Vor-Ort-Integration
- Trainings
- Support
MES LITE
-
Mit der MES LITE ist in wenigen Tagen implementiert. Die benötigte Hardware ist überschaubar, sie umfasst in aller Regel einen I/O-Controller für die Maschinen-Konnektivität sowie ein Edge-Gateway als zentrale Schnittstelle zwischen Shopfloor und Topfloor.
Fabrikteams können unterschiedlichste Maschinen sehr zügig digital anbinden und profitieren zeitnah von den Vorteilen der Lösung: Echtzeit-Transparenz über die Leistung der Maschinen sowie höhere Effizienz durch präzise Analysen und standardisierte Reports – die Basis für den datengetriebenen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP).
-
Mit einer MES-Lösung für die fertigende Industrie steht eine Lösung zur Verfügung, die alle Maschinensignale aus der Fabrik zu einem Echtzeit-Datenmodell wandelt. Mit ihm können Fabrikteams anschließend Leistungszustände der Maschinen präzise in vorkonfigurierter Reports auf einem zentralen Dashboard und auf allen gewünschten Computer-Endgeräten analysieren. So wird die Lösung zu einem wichtigen Instrument modernen Shopfloor Managements.
Die enthaltenen Pakete sind vordefiniert und standardisiert. Gängig sind Maschinendaten- und Betriebsdatenerfassung (MDE/BDE) sowie wichtige Kennzahlen wie die Gesamtanlageneffektivität OEE (Overall Equipment Effectiveness).
Beratung
-
In der heutigen schnelllebigen Fertigungswelt ist Effizienz entscheidend. Unsere innovativen MES-Lösungen bieten Ihnen die Werkzeuge, um Ihre Produktion zu optimieren, Kosten zu senken und Ihr Unternehmen für den globalen Wettbewerb zu rüsten. Unsere Experten analysieren Ihre individuelle Ausgangssituation und passen Strategien sowie Technologien gezielt an Ihre Bedürfnisse an. Wir begleiten Sie bei der Implementierung, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und Ihnen Echtzeit-Einblicke in Ihre Produktionsdaten zu bieten. Gemeinsam lassen wir Ihre Smart Factory zur Realität werden.
-
Ausgehend von Ihrer Strategie erarbeiten wir mit Ihnen systematisch die relevanten Wertschöpfungsketten für Ihre Produktion. Unsere Methode dafür heißt: Iteratives Prozess-Prototyping (IPP®). In gemeinsamen Workshops legen wir gemeinsam ein verbindliches Zielbild für Ihre fachlichen Anforderungen fest. Wir fokussieren uns dabei auf notwendige Analysen der Optimierungspotenziale sowie potenzieller Risiken.
1. Ausgangssituation analysieren
Gemeinsam mit Ihnen bewerten wir Ihre individuelle Ausgangssituation. Typischerweise findet ein Vor-Ort-Besuch mit Shopfloor-Walk statt, um die Handlungsfelder zu identifizieren.
2. Handlungsfelder ableiten
Nach Erst-Analyse und Shopfloor-Walk werden die Handlungsfelder definiert und konkrete messbare Ziele festgelegt, die mit der MES-Lösung erreicht werden sollen (z.B. Reduzierung der Ausfallzeiten).
3. Anforderungen beschreiben
Wir beschreiben die fachlichen Anforderungen anhand der Rahmenvorgaben.
4. Lösung definieren
Wir definieren und beschreiben das Lösungssystem mit Architektur und Schnittstellen.
-
IPP® steht für Iteratives Prozess-Prototyping. Es handelt sich um ein iteratives Verfahren zum Design und der Umsetzung wertschöpfender Prozesse in Fertigung und Gesamtunternehmen.
Folgende Merkmale zeichnen das IPP aus:- Schnelle Ergebnisse
- Nachhaltige, qualitätsgesicherte Dokumentation für Geschäftsleitung und Mitarbeiter
- Transparenz, Ordnung, Struktur und klare Aufgabenzuordnung
-
Das Process Playbook ist der Ergebnistyp zur Darstellung von Inhalten des Iterativen Prozess-Prototypings (IPP®). Es ist vergleichbar mit einem Navigationssystem oder einem Atlas, mit deren Hilfe man von Überblicksdarstellungen immer feiner navigieren kann. Während bei den klassischen Ansätzen zur Geschäftsprozessarchitektur eine hohe Anzahl von verschiedenen Methoden, Vorgehensweisen und Modellen angewendet werden, ist das IPP® Process Playbook in 4 Ebenen mit klar und eindeutig definierten Symbolen, Darstellungsformen und Inhalten strukturiert, die aufeinander abgestimmt sind.
-
Mit der IPP®-Ebenendarstellung werden die verschiedenen Sichtweisen der unterschiedlichen Stakeholder im Unternehmen adressiert und eine transparente Nachvollziehbarkeit für Führungskräfte und Mitarbeiter gewährleistet. Dadurch können komplexe betriebswirtschaftliche Sachverhalte einfach und intuitiv, aber in hinreichendem Umfang und integriert für Kunden transparent und nutzbar gemacht werden. Das IPP® Process Playbook zeigt Wege von scheinbarer Komplexität zur Einfachheit und es wird ein konsistenter Übergang von Prozessen der einzelnen Fachbereiche zur IT gewährleistet.
Das IPP® Process Playbook hat seinen Ursprung im SAP-Umfeld, weitere Informationen befinden sich unter: www.processplaybook.com
Weiterführende Fragen
-
Ein Ishikawa-Diagramm, auch als Fischgrätendiagramm oder Ursache-Wirkungs-Diagramm bekannt, ist ein Analysewerkzeug zur systematischen Identifikation von Problemursachen. Es hilft, diese in Kategorien einzuteilen und so das Problem besser zu verstehen und Lösungen zu entwickeln.
- Ein Ishikawa-Diagramm ist ein Werkzeug zur Identifizierung und Analyse von Ursachen und Wirkungen.
- Es wird auch als Ursache-Wirkungs-Diagramm oder Fischgräten-Diagramm bezeichnet.
- Es dient dazu, komplexe Probleme zu strukturieren und die wichtigsten Ursachen zu identifizieren.
- Es wurde von Kaoru Ishikawa entwickelt und ist ein wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung
Andere Namen dafür sind: Fischgräten-Diagramm, Fehlerbaum-Diagramm, Ursache-Wirkungs-Diagramm.
-
Das Diagramm wurde von Kaoru Ishikawa, einem japanischen Chemieingenieur und Pionier des Qualitätsmanagements, in den 1940er Jahren entwickelt, um die Ursachen von Qualitätsproblemen in der Fertigungsindustrie besser zu analysieren.
-
Das Diagramm wird verwendet, um:
- Die tieferliegenden Ursachen eines Problems zu identifizieren.
- Probleme systematisch und visuell zu analysieren.
- Lösungen im Qualitätsmanagement, im Projektmanagement oder für die Prozessoptimierung zu entwickeln.
- Ursachen zu kategorisieren – z. B. Mensch, Maschine, Material.
-
- Unklare Problemdefinition
- Vernachlässigung relevanter Kategorien oder Ursachen
- Oberflächliche Analyse, die die wahren Ursachen nicht erfasst
- Fehlende Teamarbeit und Zusammenarbeit bei der Erstellung
-
Durch eine Werkzeugverwaltung wird dafür gesorgt, dass die Informationen der unterschiedlichen Werkzeuge in einem übersichtlichen Rahmen verwaltet werden. Eine Datenbank sorgt dafür, dass die Daten der Werkzeuge gespeichert werden. Die Datenbank ist dabei an eine entsprechende Werkzeugverwaltungs-Software gekoppelt. Eine Werkzeugverwaltung kommt in der Fertigung zum Einsatz. Die Software ist in der Lage, verschiedene Arten von Daten, Grafiken, etc. der Werkzeuge zu erfassen.
Die Werkzeugverwaltung ist zudem dafür zuständig, dass der Fertigungsprozess ohne Fehler vonstattengeht. Innerhalb der Werkzeugverwaltung unterscheidet man zwischen Stammdaten und Bewegungsdaten.
Stammdaten
Unter Stammdaten versteht die Informatik und Betriebswirtschaftslehre Daten von verschiedenen Objekten, die im Unternehmen verwendet werden. Zu diesen Daten zählen beispielsweise Informationen von Produkten, den Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden, welche für Geschäftsprozesse des Unternehmens relevant sind. Dabei werden die Stammdaten auf unterschiedliche Weise gespeichert, wie etwa in Datenbanken oder einfach als Datei. Bei Stammdaten handelt es sich immer um statische Informationen.
Stammdaten von Werkzeugen umfassen
- die geometrischen Funktionen,
- den Aufbau der Werkzeuge sowie die Art,
- wie man diese Werkzeuge verwenden kann.
Die Daten der Werkzeuge beinhalten innerhalb der Stammdaten die Werkzeugbeschreibungen sowie die Art, wie die Werkzeuge von Mitarbeitern und Maschinen verwendet werden sollen. Stammdaten von Werkzeugen beinhalten nicht Daten über die Verfügbarkeit der Werkzeuge, da dies von anderer Software übernommen wird.
Bewegungsdaten
Bei Bewegungsdaten handelt es sich häufig um das Gegenteil von Stammdaten. Im Gegensatz zu Stammdaten sind Bewegungsdaten dynamisch, da sich ständig ändern. Auf eine Datenbank bezogen sind Bewegungsdaten beispielsweise Kundendaten. Zu den Kundendaten gehören zum Beispiel die Bestellungen der Kunden sowie Vertragsdaten. Zu Bewegungsdaten zählen auch Änderungen des Bestandes in einem ERP-System.
Wissen, welches verfügbar ist, wird in den Stammdaten berücksichtigt. Dieses ist jedoch nur dann möglich, wenn an den Arbeitsplätzen der Mitarbeiter Daten für die jeweiligen Aufgaben vorhanden sind. Werkzeugdaten lassen sich leicht mithilfe der Werkzeugverwaltungs-Software mit Drittanbieter-Software koppeln. Dies passiert entweder über den Zugriff auf die Datenbank der Werkzeugverwaltungs-Software oder durch Zugriff auf diverse Schnittstellen.
-
Diese Art von Software erfasst den Lebenszyklus der Fertigungsmittel und pflegt diesen. Folgende Faktoren spielen hier eine Rolle:
- Beschaffung der Werkzeuge mit der Frage, zu welchem Zeitpunkt welches Werkzeug benötigt wird.
- Wie werden die einzelnen Werkzeuge zu einem kompletten Werkzeug zusammengebaut?
- Die Art der Verwendung: An welcher Maschine wird welches Werkzeug verwendet?
- Schleifen sowie Entsorgen des Werkzeuges.
Die Werkzeugverwaltungs-Software ist zudem der Dreh- und Angelpunkt der verschiedenen Werkzeugdaten. Daten zum Produkt, Schnittbedingungen sowie 3D-Modelle erleichtern der Arbeitsvorbereitung sowie -planung die Arbeit erheblich. Für die NC-Programmierung ist die Übergabe der Daten der Werkzeuge sowie den Schnittdaten an ein CAM-System von Nutzen. Weitere Profiteure der Werkzeugverwaltungs-Software sind der Einkauf, der vom ERP-System Informationen zur Bestellmenge der Schneidesätze zur Verfügung gestellt bekommt, Lagersysteme, Fertigungssteuerung sowie Voreinstellgeräte.
-
Eine ausgefeilte Werkzeugverwaltungs-Software bietet einige Vorteile, die nachfolgend aufgelistet sind:
- Produktionsmittel werden effektiver genutzt.
- Kapitalbindungen werden vermieden.
- Abteilungsübergreifend können aussagekräftige Reports erstellt werden. So kann die Einkaufsabteilung anhand der Auswertungen ablesen, wann bestimmte Teile für die Werkzeuge wieder beschafft werden müssen.
- Neue Werkzeuge können durch die intelligente Datenbanksuche schnell gefunden werden.
- Aktuelle Empfehlungen und Informationen der Werkzeughersteller stehen durch die Software zur Verfügung.
-
Die Komplett-Werkzeuge werden innerhalb der sogenannten Werkzeugliste erfasst und geführt. Die ausdruckbare Werkzeugliste enthält Informationen zur Bestückung (und somit für das Kommissionieren) der Komplett-Werkzeuge. In vielen Fällen bein-halten die Werkzeuglisten weitere Angaben zu den Komplett-Werkzeugen. Dazu zählen etwa Informationen für NC-Programme, Pläne für das Aufspannen und den Druck etc. In den Kopfdaten befinden sich Angaben zur eindeutigen ID, sowie Angaben, für welche Maschine welches Werkzeug geeignet ist. Eine Liste, welche die Werkzeuge enthält, führt alle Komplett-Werkzeuge auf, welche für einen Vorgang benötigt werden. Diese Liste enthält zudem für das NC-Programm wichtige Informationen, wie etwa, in welcher Abfolge die Werkzeuge vom NC-Programm abgearbeitet werden sollen. Auch stehen in der Liste bestimmte Angaben, die nur für einen speziellen Ablaufvorgang gelten, wie beispielsweise die minimale Länge, in der die Maschine scheiden soll. In der Rüstliste stehen schließlich die Informationen, die für die Kommissionierung und das Zusammenbauen der Werkzeuge relevant sind.
